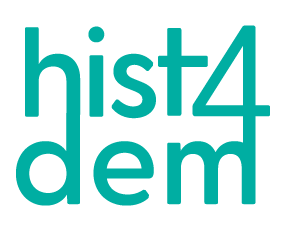Was genau ist hist4dem?
Historiker*innen für eine demokratische Gesellschaft (hist4dem) ist ein unabhängiges Netzwerk von Historiker*innen und historisch arbeitenden Personen, das sich dafür einsetzt, demokratische Strukturen durch Forschung, Bildung und Öffentlichkeitsarbeit zu fördern und zu bewahren.
Wer kann Teil des Netzwerks werden?
Das Netzwerk richtet sich an alle Menschen, die historisch arbeiten, in der historischen Bildung tätig sind oder an den Tätigkeitsfeldern von hist4dem interessiert sind (z. B. Lehrende, Wissenschaftler*innen, freischaffende Historiker*innen, Personen aus der außerschulischen Bildungsarbeit, Archivar*innen, Studierende) und die sich aktiv für Demokratie und Grundrechte engagieren möchten.
Wie kann ich dem Netzwerk beitreten?
Der Beitritt erfolgt über die Mailingliste.
- Besuche die Kontaktseite von hist4dem.
- Dort findest du den Link zur Mailingliste: https://www.listserv.dfn.de/sympa/info/hist4dem.
- Wähle links in dem Menü unter ‚Listen-Hauptseite‘ den Menüpunkt ‚Abonnieren‘.
- Gib deine E‑Mail-Adresse und Deinen Namen ein und sende das Formular ab.
Du bist nun Teil der Mailingliste/des Netzwerks und erhältst ab sofort alle Informationen über die Aktivitäten von hist4dem per Mail.
Wie kann ich die Mailingliste von hist4dem abonnieren?
- Besuche die Kontaktseite von hist4dem.
- Dort findest du den Link zur Mailingliste: https://www.listserv.dfn.de/sympa/info/hist4dem.
- Wähle links in dem Menü unter ‚Listen-Hauptseite‘ den Menüpunkt ‚Abonnieren‘.
- Gib deine E‑Mail-Adresse und Deinen Namen ein und sende das Formular ab.
Du bist nun Teil der Mailingliste/des Netzwerks und erhältst ab sofort alle Informationen über die Aktivitäten von hist4dem per Mail.
Wie kann ich mich von der Mailingliste abmelden?
Wie kann ich mich von der Mailingliste abmelden?
- Besuche die Kontaktseite von hist4dem.
- Dort findest du den Link zur Mailingliste: https://www.listserv.dfn.de/sympa/info/hist4dem.
- Wähle links in dem Menü unter ‚Listen-Hauptseite‘ den Menüpunkt ‚Abbestellen‘.
- Gib deine E‑Mail-Adresse ein und sende das Formular ab.
Bin ich automatisch im Netzwerk/in der Mailingliste wenn ich das Positionspapier unterschrieben habe?
Nein, wer die Mailingliste abonnieren und damit dem Netzwerk beitreten möchte, muss das selbständig tun (siehe oben: „Wie kann ich dem Netzwerk beitreten?“). Die Mitzeichnung des Positionspapiers erfolgt unabhängig davon.
Wie kann ich mich über laufende Aktivitäten von hist4dem informieren?
Wenn du die Mailingliste abonniert hast, erhältst du automatisch regelmäßige Updates über:
- regelmäßige Netzwerktreffen
- Veranstaltungen
- Aktionen (z. B. Themenwochen zu Demokratie)
Alle aktuellen Aktivitäten werden über diese Liste kommuniziert.
Wie kann ich bei hist4dem mitarbeiten?
Durch die Teilnahme an den Netzwerktreffen, die Mitarbeit in den Arbeitsgruppen, die Organisation von Veranstaltungen, die Planung von Aktivitäten. Die Ansprechpartner*innen der Arbeitsgruppen findest Du unter dem Menüpunkt ‚Arbeitsgruppen‘. Bei Interesse einfach dort oder per Email unter info@hist4dem.de melden!
Wie kann ich hist4dem finanziell unterstützen?
Wir organisieren gerade ein Spendenkonto. Wenn Du schon jetzt hist4dem finanziell unterstützen möchtest, dann schick eine Mail an info@hist4dem.de.