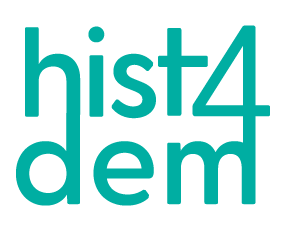Aktionen zum 9. November
online/via Zoom
Der 9. November: Aufbrüche, Abgründe und die Fragilität der Demokratie
Sonntag, 9. November 2025, 16.00-18.15 Uhr
Details
Am 9. November jähren sich mehrere Schlüsselereignisse der deutschen Geschichte. Er steht für den Aufbruch in die Demokratie, aber auch für deren Fragilität. Anlässlich dieses zentralen Datums lädt hist4dem vier Expert:innen zu einer gemeinsamen Diskussion ein: über den 9. November als Chiffre einer komplexen Geschichte, über die Zerbrechlichkeit demokratischer Ordnungen und darüber, dass Demokratie nur bestehen kann, wenn Bürger:innen sich aktiv für sie engagieren. In Zeiten, in denen die Demokratie unter Druck steht, ist ein fundierter Blick auf ihre Geschichte wichtiger denn je.
Line-up:
Der 9. November 1918: Kipppunkt der deutschen Demokratiegeschichte? (Kirsten Heinsohn, Forschungsstelle für Zeitgeschichte, Hamburg)
Der 9. November 1923 und der Hitlerputsch: Größenwahn oder Machtstrategie? Wie ein gescheiterter Putsch Hitler bekannt machte (Nadine Rossol, University of Essex)
Der 9. November 1938: Die Novemberpogrome (TITEL tba) (Michael Wildt, HU Berlin)
Der 9. November 1989: Der Mauerdurchbruch und die Freiheitsrevolution (Ilko-Sascha Kowalczuk, Berlin)
Wir laden Sie und Euch herzlich ein, zuzuhören und mitzudiskutieren. Zuschalten können Sie sich auf Zoom unter https://uni-koeln.zoom.us/j/99979537933?pwd=hGC2szPv31HkasIOesBED3VtaBuFQ1.1
Göttingen
Theateraufführung „Was heißt hier ,Wir‘? Auf der Suche nach der deutschen Identität“

Dienstag, 18.11.2025, 11:30 Uhr und 18:00 Uhr
Aula am Waldweg, Waldweg 26, 37073 Göttingen
Details
Das Theaterstück nimmt Sie mit auf eine Suche nach der deutschen Identität. Die Produktion setzt sich mit den brennenden Fragen unserer Zeit auseinander:
- Was bedeutet es, deutsch zu sein?
- Was ist „undeutsch“?
- Wie beeinflusst die Vergangenheit unsere Gegenwart und wie gestalten wir unsere Zukunft?
Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten.
Alle weiteren Informationen können dem Flyer entnommen werden.
Vergangene Aktionen
Aktionswoche „Zeitalter der demokratischen Revolutionen“, 4.-14. Juli 2025
Die Jahrestage der Declaration of Independence am 4. Juli 1776 und des Sturms auf die Bastille in Paris am 14. Juli 1789 waren uns Anlass, an die demokratischen Revolutionen und Traditionen in Europa und den Amerikas zu erinnern.
Elf Tage lang wurden zentrale historische Texte vorgestellt, die von Idealen und Erfolgen, aber auch Versäumnissen und dem Scheitern der demokratischen Revolutionen erzählen. Diese Quellen neu zu lesen, schärft den Blick auf unsere eigene Gegenwart.
Hier geht es zur Liste der Veranstaltungen.
Aktionswoche „Demokratie stärken“, 5.–9. Mai 2025
Zum Gedenktag am 8. Mai haben wir – die Initiative Historiker*innen für eine demokratische Gesellschaft (hist4dem) – mit einer Aktionswoche ein Zeichen für eine starke und wehrhafte Demokratie gesetzt. In zahlreichen Vorträgen, Diskussionsveranstaltungen und Zeitzeug:innengesprächen, Rundgängen und Workshops wurden Menschen dazu ermutigt, aktiv für eine Gesellschaft einzutreten, die sich auszeichnet durch Solidarität, Vielfalt, Rechtsstaatlichkeit, Offenheit und den Schutz der Menschenrechte.
Hier geht es zur Liste der Veranstaltungen.
Wir bitten Mitglieder des Netzwerks hist4dem darum, ihre Veranstaltungen unter aktionen@hist4dem.de zu melden.