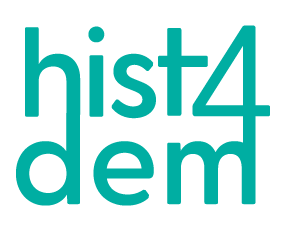Was bedeutet das „Neutralitätsgebot“?
Das „Neutralitätsgebot“ sorgt an vielen Stellen für Unsicherheit. Nicht wenige Leute glauben, dass man als Lehr- und Führungskraft in Universitäten, Schulen oder anderen öffentlichen Institutionen historischer Bildung keine politische Meinung äußern und nicht politisch aktiv werden dürfe. Auch die Ansicht, dass für Beamtinnen und Beamte andere Regeln gelten als für Angestellte, ist weit verbreitet. All dies ist nicht der Fall: Beamt*innen und Angestellte sind alle gleichermaßen dem Grundgesetz verpflichtet und müssen demnach Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die freiheitlichen und demokratischen Grund- und Menschenrechte vermitteln. Sie sind verpflichtet, eine klare Haltung gegen menschenverachtende Äußerungen jeglicher Art sowie gegen Gewaltverherrlichung einzunehmen. Es ist ihre Aufgabe, Schüler*innen sowie Bürger*innen zu lehren und stetig daran zu erinnern: Es stellt einen hohen Wert dar, sich aktiv für die Würde des Menschen (und zwar aller Menschen unabhängig von Herkunft, Religion, sexueller Orientierung etc.) und eine demokratische Gesellschaft einzusetzen.
Die Kultusministerkonferenz hält unmissverständlich fest: „Für die Auseinandersetzung mit historisch-politischen Fragen im oder außerhalb des Unterrichts, in Vorlesungen oder Seminaren gelten Grundsätze, die sich an unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung orientieren – wie die Rechtsstaatlichkeit, das Demokratieprinzip oder die Menschenwürde im Bewusstsein unserer historischen Verantwortung. Die notwendige Überparteilichkeit staatlichen Handelns ist hierbei nicht mit Wertneutralität zu verwechseln. Positionen oder Stellungnahmen, die diesen Werten widersprechen oder diese angreifen, können nicht neutral und erst recht nicht widerspruchslos stehengelassen werden.“
Der „Beutelsbacher Konsens“ von 1977 formuliert drei zentrale didaktische Prinzipien politischer Bildung:
- Das Überwältigungs- bzw. Indoktrinationsverbot. Lehrkräfte dürfen ihre eigene politische Meinung zwar äußern, müssen diese aber als solche klar kenntlich machen. Dabei dürfen sie ihre politische Meinung nicht als allgemeingültig darstellen.
- Das Kontroversitätsgebot. Kontroverse Themen sollen multiperspektivisch diskutiert werden.
- Befähigung zur politischen Teilhabe. Lehrende müssen mit ihrem Handeln das Ziel verfolgen, Schüler*innen zur politischen Teilhabe zu befähigen.
Auch hier geht es nicht um Neutralität: Aus dem Überwältigungsverbot oder der kontroversen Diskussion von Unterrichtsinhalten folgt nicht, dass die Lehrkraft keine eigenen Positionen haben und offenlegen darf.
Weiterführende Links:
- Bundeszentrale für politische Bildung, Dossier Bildung: «Mythos Neutralität in Schule und Unterricht»
- Friedrich Ebert Stiftung, Joachim Wieland: «Was man sagen darf: Mythos
- Neutralität in Schule und Unterricht» (zur Klärung der Rechtslage mit Fallbeispielen)
- GEW, Aktuelles: «Debatte um ‘Neutralität’ im Klassenzimmer»
- Institut für Menschenrechte
Was ist Extremismus?
Als Extremismus werden sämtliche Bestrebungen bezeichnet, welche die zentralen Grundwerte, Normen und Regeln unseres Staates abschaffen oder einschränken wollen. Allen voran zählen dazu die Unantastbarkeit der Menschenwürde (Art. 1 Grundgesetz), das Demokratieprinzip, das alle Bürger:innen gleichberechtigt am Prozess der politischen Willensbildung teilhaben lässt, und die Rechtsstaatlichkeit, wonach der Staat nur im Rahmen bestehender Gesetze handeln darf. Zusammen werden diese drei Prinzipien auch als „freiheitlich demokratische Grundordnung“ (kurz: „FDGO“) bezeichnet. Extremist:innen beziehungsweise extremistisch orientierte Personen richten sich gegen diese freiheitlich demokratische Grundordnung und lehnen beispielsweise das Grundgesetz, die freie Presse und demokratische Institutionen ab. Oft sind sie empfänglich für Verschwörungstheorien, befürworten Gewalt zur Durchsetzung ihrer eigenen antidemokratischen und antipluralistischen Ziele oder propagieren sogar Terrorismus als die militanteste und radikalste Form des Extremismus. Das Bundesamt und die Landesämter für Verfassungsschutz beobachten unterschiedliche Formen von Extremismus und teilen diese aktuell in die folgenden sechs Kategorien ein: Rechtsextremismus, Reichsbürger und Selbstverwalter, Islamismus und islamistischer Terrorismus, auslandsbezogener Extremismus,Linksextremismus und Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates.
Was ist die „Extremismustheorie“?
Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges beziehungsweise im Kontext des aufkommenden Kalten Krieges entstand in den Politikwissenschaften die sogenannte „Extremismustheorie“. Laut diesem theoretischen Modell existiert eine Links-Rechts-Achse des politischen Spektrums, in dessen Mitte sich die Kräfte befinden, welche die freiheitlich demokratische Grundordnung erhalten wollen. Je weiter entfernt eine Position von der politischen Mitte ist, desto radikaler wird sie eingestuft, wobei Links– und Rechtsradikalismus noch unter den Schutz der Meinungsfreiheit fallen. Die äußersten Ränder auf der Links-Rechts-Achse werden dagegen als Links- bzw. Rechtsextremismus bezeichnet und stets als verfassungsfeindlich bewertet. Der „Extremismustheorie“ zufolge wird das politische System der Bundesrepublik Deutschland von „links“ und „rechts“ gleichermaßen bedroht, was auf folgende Kritikpunkte stößt. Erstens ist empirisch klar belegt, dass die rechtsextrem motivierte Gewalt und vor allem die daraus resultierende Anzahl an Todesopfer um ein Vielfaches höher ist, sodass Gewalt von links und rechts nicht gleichsetzt werden könnten. Zweitens fokussiert sich die „Extremismustheorie“ auf eine bipolare Rechts-Links-Konfliktstruktur in unserer Gesellschaft, wodurch nicht eindeutig zuordenbare Extremismusformen wie etwa „Islamismus“ vernachlässigt werden. Drittens schreibt dieses theoretische Modell der politischen Mitte eine ausgleichende Wirkung zu und lässt dabei außer Betracht, dass extremistische Einstellungen auch in der Mitte der Gesellschaft existieren können. In den Sozialwissenschaften zählt die „Extremismustheorie“ daher nicht zum Standard der Forschung.
Extremismusprävention
Für Radikalisierung gibt es vielfältige Ursachen, die von individuellen über familiäre bis zu gesellschaftlichen Faktoren reichen. Vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat die Suche nach der eigenen Identität sowie sozialer Anerkennung und Bindung einen hohen Stellenwert und nicht jede radikale Idee ist eine Gefahr für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung (FDGO). Zur Erkennung von Radikalisierungstendenzen im analogen wie im digitalen Raum ist Wissen über extremistische Ideologien und Szenecodes sowie eine professionelle sozialpädagogische Einschätzung von zentraler Bedeutung. Extremismusverdacht besteht in jedem Fall, wenn die Bereitschaft wächst, die radikalen Positionen mit illegitimen Mitteln wie der Anwendung von Gewalt durchzusetzen. In der Bundesrepublik existieren viele verschiedene Projekte und Programme von Extremismusprävention und Demokratieförderung, siehe dazu „weiterführende Links“.
Historische Rechtsextremismusforschung
Die historische Rechtsextremismusforschung ist im Grunde so alt wie die extreme Rechte nach 1945 selbst. Aufgrund starker Kontinuitäten im akademischen Betrieb der Zeitgeschichte kamen erste Impulse für die Erforschung von Re-Nazifizierungstendenzen und antidemokratischem Nationalismus vor allem von emigrierten Wissenschaftler:innen. Erst ab den 1960er Jahren beschäftigten sich westdeutsche Zeithistoriker:innen zunehmend mit Themen wie Geschichtsrevisionismus und der Leugnung der NS-Verbrechen. In den beiden Folgejahrzehnten entwickelte sich auch nominell die Disziplin „Rechtsextremismusforschung“, die sich zunächst insbesondere auf extrem rechte Parteien und Organisationen fokussierte. Trotz einer pogromartigen Gewaltwelle nach der deutschen Wiedervereinigung blieb die Ereignisgeschichte von Rechtsextremismus, Rassismus und Fremdheitserfahrungen weiterhin unterbeleuchtet. Das Erstarken der vom Verfassungsschutz inzwischen als „gesichert rechtsextrem“ eingestuften AfD hat in den letzten Jahren jedoch zu einer stärkeren Erforschung der Ideen-, Organisations- und Gewaltgeschichte der radikalen und extremen Rechten geführt, bei der auch die Untersuchung der sogenannten „politische Mitte“ nicht außer Acht bleiben darf.
Weiterführende Links:
- https://www.demokratie-leben.de
- https://www.bpb.de/mediathek/video/515343/tipps-fuer-extremismuspraevention/
- https://mosaik-deutschland.de/projekte/extremismuspraevention/
- https://www.verfassungsschutz.de/DE/home/home_node.html
- https://www.lpb-bw.de/was-ist-extremismus
- https://www.bpb.de/themen/rechtsextremismus/dossier-rechtsextremismus/200099/kritische-anmerkungen-zur-verwendung-des-extremismuskonzepts-in-den-sozialwissenschaften/
Was ist Gender?
Das englische Wort „Gender“ wurde in Deutschland zunächst in wissenschaftlichen Kontexten verwendet. Es macht deutlich, dass es neben dem biologischen Geschlecht (sex) gesellschaftliche Rollen und kulturelle Vorstellungen darüber gibt, wie sich ein bestimmtes Geschlecht zu präsentieren hat und woran es im Alltag erkennbar sein soll.
Durch diese sprachliche Unterscheidung wird hervorgehoben, dass Geschlecht historisch, sozial und kulturell bedingt und damit veränderlich ist. Menschen haben ihre Zugehörigkeit zu einem Geschlecht in früheren Zeiten anders ausgedrückt als es heute üblich ist, und auch in Zukunft wird dies vermutlich wiederum anders geschehen. Es gibt also kein feststehendes Gender, sondern nur historisch, sozial und politisch wandelbare Vorstellungen davon, wie Geschlechter zu sein haben. Inzwischen wird zudem betont, dass selbst das biologische Geschlecht nicht so eindeutig ist, wie lange angenommen wurde.
In den Geschichts-, Sozial- und Kulturwissenschaften gehört Gender mittlerweile – neben Kategorien wie „Klasse“ oder „Ethnizität“ – zu den grundlegenden Analysekategorien. Gleichzeitig ist der Begriff in den vergangenen Jahren, insbesondere von der radikalen Rechten, zu einem Kampfbegriff gemacht worden. Die Debatten um Gender verlaufen in diesem Kontext oft unsachlich und sind emotional stark aufgeladen. Gender wird dabei als Feindbild konstruiert und in Verschwörungsdiskursen als Teil einer sogenannten „woken Agenda“ dargestellt – einer abwertenden Bezeichnung für eine angebliche Agenda übertriebener politischer Korrektheit.
Aus diesem Umfeld stammen Begriffe wie „Gender-Gaga“, „Genderwahn“ oder „Genderideologie“. Der Ausdruck „Genderwahn“ wurde 2017 zum Unwort des Jahres erklärt. Die Jury begründete ihre Entscheidung damit, dass in konservativen bis rechtspopulistischen Kreisen Bemühungen um Geschlechtergerechtigkeit – von geschlechtergerechter Sprache über die Ehe für alle bis hin zur Anerkennung von Transgender-Personen – mit diesem Schlagwort pauschal diffamiert würden. Die Wahl zum Unwort des Jahres machte deutlich, dass mit solchen Begriffen versucht wird, Gender als unwissenschaftlich abzuwerten und ins Lächerliche zu ziehen.
Gibt es eine „Gendersprache“?
Nein. Es gibt jedoch eine gendersensible bzw. gendergerechte Sprache, die darauf abzielt, alle Menschen gleichberechtigt sichtbar zu machen und einzuschließen. Der Duden und der Rat für deutsche Rechtschreibung empfehlen eine geschlechtergerechte Sprache, die zumindest die Berücksichtigung von Männern und Frauen sicherstellt. Dabei verweisen sie auf die im Grundgesetz festgeschriebene Gleichberechtigung: „Die Gleichbehandlung der Geschlechter wird im Artikel 3 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland garantiert. Um Gleichstellung zu realisieren, ist der Sprachgebrauch ein relevanter Faktor. Bei Bezeichnungen wie die Antragsteller; alle Schüler; Kollegen ist sprachlich nicht eindeutig, ob nur auf Männer referiert wird […]. Das Deutsche bietet eine Fülle an Möglichkeiten, geschlechtergerecht zu formulieren.“
Der Ausdruck „Gendersprache“ ist daher kein neutraler Begriff, sondern ein politischer Kampfbegriff, der vor allem von rechten Kreisen genutzt wird, um geschlechtergerechte Ausdrucksweisen zu diskreditieren.
Da Sprache unsere Wahrnehmung der Welt prägt, ist geschlechtergerechte Sprache ein zentraler Baustein, um Gleichstellung zu fördern. Das Bundesverfassungsgericht stellte 2017 fest, dass Menschen, die sich dauerhaft weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen lassen, vor Diskriminierung geschützt sind. Es entschied, dass ihre Grundrechte verletzt werden, wenn das Personenstandsrecht sie zwingt, sich einem der beiden Geschlechter zuzuordnen, ohne eine weitere positive Eintragungsmöglichkeit vorzusehen.
Seitdem stellt sich die Frage, wie dieser rechtlichen Realität auch sprachlich Rechnung getragen werden kann. In der Praxis haben sich verschiedene Formen der gendersensiblen Schreibweise etabliert, eine einheitliche Lösung gibt es bislang jedoch nicht. Der Rat für deutsche Rechtschreibung bekräftigte 2021, „dass allen Menschen mit geschlechtergerechter Sprache begegnet werden soll und sie sensibel angesprochen werden sollen“.
Im Zentrum steht dabei das Ziel, Sprache so zu gestalten, dass sich alle Menschen – auch jenseits der Zweigeschlechtlichkeit – angesprochen fühlen und die Vielfalt unserer Lebenswelt angemessen zum Ausdruck kommt.
Anstatt die Demokratisierung von Sprache als Teil gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses zu begreifen, hat die Politisierung des Diskurses durch den Kampfbegriff „Gendersprache“ zu einer starken Emotionalisierung geführt und die Suche nach Lösungen in diesem Prozess verzögert. Nicht zuletzt aufgrund des zunehmenden Drucks von rechts haben inzwischen mehrere Landesregierungen in Deutschland das Gendern mit Sonderzeichen in offiziellen Texten untersagt. Im August 2025 sprach sich Kulturstaatsminister Wolfram Weimer für ein generelles Verbot gendergerechter Sprache mit Sonderzeichen in allen öffentlich geförderten Institutionen aus. Er begründete dies mit dem Ziel, eine Sprachregelung zu schaffen, „die für alle nachvollziehbar ist und breite Akzeptanz findet“. Mit dieser Begründung erhebt Weimer den Anspruch, für die gesamte Gesellschaft zu sprechen, obwohl die Sprachpraxis und die Diskussionen in Wissenschaft, Medien und Alltag gerade zeigen, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt und eine „einheitliche Akzeptanz“ nicht besteht. Gleichzeitig bezeichnete er das Gendern als „bevormundende Spracherziehung“, die die „Spaltung der Gesellschaft vertiefe“ – eine Argumentation, die sich klar in die neurechten Verschwörungsdiskurse um die „woke Agenda“ einfügt, wie sie u.a. von der rechtsextremistischen AfD propagiert werden.
Was sind Gender Studies?
Ausgangspunkt für die Gender Studies war die Frauenforschung der 1970er und 1980er Jahre. Ihr Ziel war es, Frauen sichtbar zu machen und die Bedeutung von Geschlecht für Geschichte und Gegenwart aufzuzeigen. Daraus hat sich eine vielseitige Geschlechterforschung – heute Gender Studies – entwickelt, die neben Frauen auch Männer und Männlichkeiten in den Blick nimmt (Masculinity Studies). Ein weiterer Zweig setzt sich kritisch mit dem System der Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität auseinander (Queer Studies).
Die Gender Studies erforschen die Bedeutung und Wirkung von Geschlecht und Geschlechterverhältnissen. Dabei geht es, so der Wissenschaftsrat in seinen „Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Geschlechterforschung in Deutschland“ von 2023, unter anderem um folgende Fragen:
- Was bedeutet „Geschlecht“ in unterschiedlichen Epochen, Kulturen und gesellschaftlichen Bereichen?
- Wie entstehen Geschlechterverhältnisse, und wie werden sie gestaltet?
- Welche Rolle spielen Geschlechterdifferenzen, Geschlechterrollen und Geschlechtsidentitäten für einzelne Menschen und für die Gesellschaft insgesamt?
Wegen dieser breiten Fragestellungen versteht sich die Geschlechterforschung als interdisziplinäres Forschungsfeld, das nicht auf eine einzelne Disziplin beschränkt ist.
Geschlechterforschung kann also in fast allen wissenschaftlichen Fächern gewinnbringend durchgeführt werden. In der geschlechtersensiblen Medizin wird z.B. zu den unterschiedlichen Symptomen bei Männern und Frauen bei Krankheiten wie einem Herzinfarkt geforscht.
In der Geschichtswissenschaft erweitert und differenziert eine gendergeschichtliche Perspektive den Blick auf den Gegenstand in allen Epochen und zu nahezu allen Themen. Geschlechtergeschichte untersucht einerseits jeweils spezifische Erfahrungen und Lebensbedingungen von Frauen und Männern in der Geschichte. Sie thematisiert aber auch die Frage, wie sich Vorstellungen über und Zuschreibungen an die Geschlechter sowie ihre Beziehung zueinander in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen niedergeschlagen und das Denken und Handeln von Menschen geprägt haben: als identitätsstiftende Elemente nationalstaatlicher oder auch ethnisch-kultureller Zugehörigkeit, als Argumente für Ausgrenzungen, als Metaphern in der politischen und alltäglichen Sprache, oder auch als Leitvorstellungen in der Familien- und Sozialpolitik. Dabei wird zunehmend auch berücksichtigt, wie Geschlecht mit anderen gesellschaftlichen Kategorien wie Klasse, „Race“ oder Religion verschränkt ist – ein Ansatz, der als Intersektionalität bezeichnet wird.
Geschlechterforschung wird oft scharf angegriffen und als unwissenschaftlich denunziert. Folgt man den Soziologinnen Sabine Hark und Paula-Irene Villa, die sich schon 2015 mit Anti-Genderismus befasst haben, ist das mehr als ein Angriff auf die Geschlechterforschung allein und auch mehr als ein Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit. Nach ihnen handelt es sich um einen Angriff auf die Wissenschaft und die Universität als Ort, an dem gesellschaftliche Wirklichkeit als Teil einer offenen Gesellschaft verhandelt wird. Dies wird durch die zahlreichen parlamentarischen Initiativen der AfD-Fraktion im Bundestag und in Landtagen belegt, in denen sie detailliert die Finanzierung und Inhalte von Gender- und Diversitätsprojekten an Hochschulen hinterfragt und diese u.a. als „Pseudowissenschaften“ und „links-grün-rote Umerziehung von oben“ diskreditiert. Diese Beispiele verdeutlichen, dass die Angriffe auf die Geschlechterforschung eine politische Dimension haben, die die Wissenschaftsfreiheit und die gesellschaftliche Debatte über Geschlechterfragen infrage stellt.
Oft wird behauptet, mit Gender-Professuren würden Steuergelder verschwendet. Ein Blick in die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zeigt jedoch: Im Sommersemester 2023 gab es lediglich 173 Professuren mit einer Voll- oder Teildenomination in der Frauen- und/oder Geschlechterforschung (ohne Gastprofessuren). Das entspricht weniger als 0,4 % aller Professuren an deutschen Hochschulen – bei insgesamt 50.260 Professor*innen im Jahr 2021. Es handelt sich also um einen sehr kleinen Anteil der Hochschulfinanzierung. Gleichzeitig liefert die Geschlechterforschung zentrale Erkenntnisse mit hoher gesellschaftlicher Relevanz: Sie trägt in der Medizin dazu bei, Leben zu retten, indem sie geschlechtsspezifische Unterschiede bei Symptomen und Therapien sichtbar macht; sie weist auf strukturelle Ungleichbehandlungen hin – etwa in Bezug auf Care-Arbeit, Altersarmut, Diskriminierung oder den Gender Pay Gap – und sie macht in der Geschichtswissenschaft jene Teile der Gesellschaft sichtbar, die lange unsichtbar geblieben sind.
Weiterführende Links und Literatur
- Bundesverfassungsgericht: Leitsätze zum Beschluss des Ersten Senats vom 10. Oktober 2017. https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/10/rs20171010_1bvr201916.html
- Deutscher Bundestag: Stenografischer Bericht. 114. Sitzung, Mittwoch, 5. Juli 2023. TOP 13: Antrag der AfD-Fraktion auf Evaluation sogenannter Agendawissenschaften durch den Wissenschaftsrat. https://dserver.bundestag.de/btp/20/20114.pdf
- Deutscher Bundestag: 19. Wahlperiode. Drucksache 8788, 27.03.2019. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der AfD-Fraktion „Genderkritik und die Gefahr der Spaltung der Gesellschaft durch Misandrie.“ https://kleineanfragen.de/bundestag/19/8788-genderkritik-und-die-gefahr-der-spaltung-der-gesellschaft-durch-misandrie
- Dudenredaktion (Hg.): Duden. Die deutsche Rechtschreibung. Das umfassende Standardwerk auf der Grundlage der amtlichen Regeln, 29., völlig neu bearb. u. erw. Auflage, Bd. 1, Berlin 2024 und https://www.duden.de/sprachwissen/sprachratgeber/Geschlechtergerechter-Sprachgebrauch
- Genderwahn. In: Diskursatlas Feminismus. https://www.diskursatlas.de/index.php?title=Genderwahn
- Geschlechtergerechter Sprachgebrauch. In: Duden, Sprachwissen, Sprache und Stil. https://www.duden.de/sprachwissen/sprachratgeber/Geschlechtergerechter-Sprachgebrauch
- Hark, Sabine, Paula-Irene Villa (Hg.): Anti-Genderismus. Sexualität und Geschlecht als Schauplätze aktueller politischer Auseinandersetzungen. Bielefeld: Transcript 2015.
- Heinsohn, Kirsten, Claudia Kemper: Geschlechtergeschichte. In: Docupedia-Zeitgeschichte, 04.12.2012. https://docupedia.de/zg//zg/Geschlechtergeschichte
- Näser-Lather, Marion: Reizwort: Woke. In: Geschichte der Gegenwart, 22.06.2025. https://geschichtedergegenwart.ch/reizwort-woke/
- Opitz-Belakhal, Claudia: Geschlechtergeschichte. Frankfurt a.M./New York ²2018.
- Rat für deutsche Rechtschreibung: Geschlechtergerechte Schreibung: Erläuterungen, Begründung und Kriterien vom 15.12.2023. https://www.rechtschreibrat.com/geschlechtergerechte-schreibung-erlaeuterungen-begruendung-und-kriterien-vom-15-12-2023/
- Rat für deutsche Rechtschreibung: Geschlechtergerechte Schreibung: Empfehlungen vom 26.03.2021. https://www.rechtschreibrat.com/geschlechtergerechte-schreibung-empfehlungen-vom-26-03-2021/
- Unwort des Jahres 2017: Genderwahn. https://www.unwortdesjahres.net/unwort/das-unwort-seit-1991/
- Weimer wirbt für weitere Genderverbote. In: Tagesschau vom 08.08.2025. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/gendern-kulturstaatsminister-100.html.
- Für eine «Rechtliche Einschätzung staatlicher ‘Genderverbote» vgl. https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Standpunkte/05_genderverbot.pdf?__blob=publicationFile&v=4
- Wissenschaftsrat. Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Geschlechterforschung in Deutschland (Drs. 1385-23), Köln, Juli 2023. https://www.wissenschaftsrat.de/download/2023/1385-23
Was bedeutet „Geschichtsrevisionismus“?
Grundsätzlich meint „Revisionismus“ den Versuch, etablierte Erkenntnisse, Interpretationen oder Theorien aufgrund neuer Methoden, Perspektiven oder Quellen zu überarbeiten. Hierzu muss zwischen Revisionismus im Allgemeinen und Geschichtsrevisionismus im Besonderen unterschieden werden. Da Historiker:innen keine reinen Chronist:innen sind, die Geschichte ‚einfach‘ nur erzählen, sondern sich durch neue Deutungen der Vergangenheit um ein besseres Verständnis der Gegenwart bemühen, ist die Revision – im Sinne einer Korrektur – ein normaler Bestandteil wissenschaftlichen Fortschritts. Eine Neubewertung oder -interpretation kann dabei nicht restlos objektiv und auch kein „letztes Wort“ sein. Doch basiert Geschichtswissenschaft jenseits aller Neubewertungen auf einem Fundament unbestreitbarer Fakten, wie zum Beispiel: Die Pest hat sich ereignet, Sklaverei hat existiert und der Holocaust ist eine Tatsache.
Im Gegensatz zur legitimen wissenschaftlichen Revision einer Ereignisdarstellung, versuchen extrem rechte Akteur:innen aus ideologischer Motivation historisch eindeutig bewiesene Tatsachen zu leugnen, zu verfälschen oder zu verharmlosen, um ihre politische Agenda zu befördern. Dabei beziehen sie sich oft auf die NS-Geschichte. Beispielsweise verbreiten Geschichtsrevisionisten die Position, dass keine systematische Vernichtung von Jüdinnen und Juden durch die Nationalsozialisten stattgefunden habe und dass der Holocaust ein Mythos sei – eine Behauptung, die in der Bundesrepublik Deutschland unter den Straftatbestand der Volksverhetzung (§ 130StGB, Absatz 3) fällt und mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet wird. Ebenso versuchen Geschichtsrevisionisten, die Schuld Deutschlands am Zweiten Weltkrieg zu relativieren und Hitler als „Friedenspolitiker“ darzustellen. Dementsprechend betonen sie in unredlicher und unverhältnismäßiger Weise das Leiden der deutschen Bevölkerung unter den Bombardierungen, Hungersnöten, Invasionen, der Umsiedelung ganzer Bevölkerungsteile oder der Rache der alliierten Sieger nach dem Krieg. Auf diese Weise betreiben sie eine Täter-Opfer-Umkehr.
Geschichtsrevisionisten verfolgen die Absicht, durch wissenschaftlich unlautere Mittel das etablierte Geschichtsbild entsprechend ihrer (rechtsextremen) Weltanschauung umzudeuten und dabei als legitime Fachrichtung in den Historischen Wissenschaften Anerkennung und Akzeptanz zu finden. Aus der Fülle an Quellen und Forschungsliteratur werden nur vereinzelte Dokumente berücksichtigt, die in das zu konstruierende Geschichtsbild passen, während andere ausgeblendet werden. Eine pseudowissenschaftliche Sprache und die Verwendung von Fußnoten und Verweisen täuschen über den Mangel an wissenschaftlicher Seriosität und belastbaren Argumenten hinweg, die Standards wissenschaftlicher Methodik und Quellenkritik werden nicht eingehalten. Revisionistische Darstellungen arbeiten mit emotionalisierenden Begriffen und Verschwörungserzählungen und inszenieren sich als „Gegenstimme“ zur etablierten Forschung, die als „politisch motiviert“ diskreditiert wird. Geschichtsrevisionismus ist also keine harmlose Form der Meinungsäußerung, sondern eine zielgerichtete Attacke auf Wahrheit, Erinnerung und Verantwortung und damit eine erhebliche Bedrohung für Gesellschaft, Demokratie und internationale Beziehungen.
Geschichtsrevisionismus ist nicht allein in Deutschland und Österreich in Bezug auf den Nationalsozialismus anzutreffen, sondern findet auch in anderen Zeitbereichen und Ländern seinen Niederschlag. So wird eine geschichtsrevisionistische Ansicht auf die deutsche Kolonialgeschichte von der AfD verbreitet, die die Gräuel der Kolonialherrschaft relativiert und verharmlost. Gleichzeitig wird eine Geschichtspolitik eingefordert, welche die „gewinnbringenden Errungenschaften dieser Zeit“ stärker herausstellt.[1] Kolonialrevisionistische Narrative, welche die koloniale Unterwerfung als Zivilisierungsmission umdeuten, finden sich auch in anderen europäischen Ländern, wie Frankreich, England und Spanien. Die pseudowissenschaftliche Relativierung von (faschistischen) Diktaturen und Militärregimes durch rechte und rechtsextreme Gruppen, Akteur:innen und Medien ist bei italienischen und spanischen Neofaschisten ebenso verbreitet wie in der extremen Rechten Lateinamerikas.
Weiterführende Literatur:
- Bildungsstäte Anne Frank e.V., Wie die Rechten Geschichte umdeuten. Geschichtsrevisionismus und Antisemitismus. Frankfurt am Main 2020. URL: https://www.bs-anne-frank.de/fileadmin/content/Publikationen/Themenhefte/Themenheft_Geschichtsrevisionismus_Web.pdf (zuletzt abgerufen am 15.12.2025).
- Brigitte Bailer-Galanda, „Revisionism“ in Germany and Austria: The Evolution of a Doctrine, in: Hermann Kurthen/Rainer Erb/Werner Bergmann (Hrsg.), Anti-Semitism and Xenophobia in Germany after Unification, New York/Oxford 1997. URL: https://www.doew.at/cms/download/12497/1_bailer_revisionism.pdf (zuletzt abgerufen am 15.12.2025).
- Wolfgang Benz: Die Funktion von Holocaustleugnung und Geschichtsrevisionismus für die rechte Bewegung. In: Stephan Braun, Alexander Geisler, Martin Gerster (Hrsg.): Strategien der extremen Rechten: Hintergründe – Analysen – Antworten. Verlag für Sozialwissenschaften, 2010, S. 404–418.
- Uladzislau Belavusau: Historical Revisionism in Comparative Perspective: Law Politics, and Surrogate Mourning. European University Institute, Department of Law, 2013.
[1] Deutscher Bundestag, Parlamentsnachrichten, AfD fordert anderen Blick auf Kolonialzeit. 18.12.2019. URL: https://www.bundestag.de/webarchiv/presse/hib/2019_12/674170-674170 (zuletzt abgerufen am 15.12.2025).